Verkehrte Verhältnisse. Tariftreue auf hessisch und schwarz-grüne Denkfehler – Interview mit der gewerkschaftlichen Anlaufstelle MigrAr
Interview aus express, Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit, 10/2014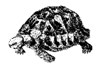
Am 11. September fand im hessischen Landtag die Anhörung zu dem neuen Tariftreue- und Vergabegesetz von Schwarz-Grün statt. Neben einigen Verbesserungen gegenüber dem bereits existierenden Gesetz – wie etwa der grundsätzlichen Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien, die nun bei der Vergabe öffentlicher Aufträge neben das ausschließlich geltende Wirtschaftlichkeitsgebot treten, und der Aufnahme des ÖPNV – beinhaltet der Entwurf aber auch echte Verschlimmbesserungen. Einer der Hauptkritikpunkte aus gewerkschaftlicher Sicht ist die Verkehrung der 2002 eingeführten Generalunternehmerhaftung in ihr Gegenteil. Gilt hier bislang, dass der Generalunternehmer im Prinzip für die Einhaltung einschlägiger Entlohnungsregelungen entlang der gesamten Subunternehmerkette haftet, sollen nach Schwarz-Grün nun die Nachunternehmer haften. Diese Konstruktion belohnt unseriöse Dumpingkalkulationen, fördert undurchsichtige Fremdvergabe, verschleiert Verantwortung und macht am Ende jene haftbar, die ohnehin die Verlierer des Systems sind: als Scheinselbständige missbrauchte Werkverträgler. Gerade weil diese oft nichts in der Hand hätten – oder von ihren Auftraggebern nichts in die Hand bekämen –, Belege vorenthalten oder gefälscht würden, Subunternehmer abtauchten, Firmennamen oder Inhaber wechselten, um sich der Verantwortung zu entziehen, sei das Institut der Generalunternehmerhaftung geschaffen worden, so VertreterInnen der gewerkschaftlichen Anlaufstelle MigrAr. Gemeinsam mit ver.di Hessen hat sich MigrAr deshalb mit Kritik an dem Entwurf der Grünen und der CDU eingemischt – auch die IG BAU macht sich für deutliche Nachbesserungen stark. Im Folgenden dokumentieren wir ein Interview des ver.di-Landesbezirks mit Kirsten Huckenbeck (express/MigrAr), das anlässlich der Gesetzesinitiative entstanden ist und anhand praktischer Erfahrungen aus der Arbeit der Anlaufstelle zeigt, welche Abhängigkeiten in der Fremdvergabe- und Subunternehmerkette bestehen und warum das hessische Gesetzesvorhaben die Verhältnisse auf den Kopf stellt.
Was ist und für was steht MigrAr?
MigrAr ist die Abkürzung für »Migration und Arbeit«. Unsere Anlaufstelle für »MigrantInnen in prekären Arbeitsverhältnissen mit und ohne Papiere« gibt es seit September 2010.
Zurzeit engagieren sich dort ehrenamtlich sechs BeraterInnen in den monatlich zwei Mal stattfindenden offenen Sprechstunden und in darüber hinaus vereinbarten Beratungsterminen. Zum UnterstützerInnenkreis zählen rund 40 Initiativen bzw. Personen aus der Rhein-Main-Region, mit denen wir eine arbeitsteilige Kooperation verabredet haben. Dazu gehören neben den regionalen Gewerkschaftsgliederungen des DGB, der NGG, IG BAU und IG Metall und dem DGB-Projekt Faire Mobilität u.a. auch das Diakonische Werk Hessen und Nassau, der Caritas-Verband Frankfurt e.V., der Evangelische Regionalverband, die Malteser Migranten Medizin, FIM (Frauenrecht ist Menschenrecht), der Hessische Flüchtlingsrat, das Projekt »kein mensch ist illegal« (kmii), der Verein demokratischer ÄrztInnen, die express-Redaktion und das »no border-netzwerk«.
MigrAr ist angesiedelt bei ver.di im DGB-Gewerkschaftshaus, dort teilen wir uns im ver.di-Servicenter auch ein Beratungsbüro mit verschiedenen anderen offenen Beratungsangeboten von ver.di, z.B. der Erwerbslosen- und der Mobbingberatung. ver.di stellt also die Räumlichkeiten, hat die Druckkosten für unsere Info-Flyer oder etwa Fahrtkosten für die Schulungen unserer BeraterInnen übernommen.
Die erste MigrAr-Anlaufstelle wurde 2008 in Hamburg gegründet. Anlass war der Fall der Chilenin Ana S., die ursprünglich als Au Pair eingereist war, dann in einem reichen Reederhaushalt mehrere Jahre völlig unterbezahlt gearbeitet hat und um mehrere zehntausend Euro Lohn betrogen worden war. Mittlerweile gibt es ver.di-getragene Anlaufstellen für »un(ter)dokumentiert Arbeitende«, so der Fachterminus, der sich in Wissenschaft und Beratungspraxis durchgesetzt hat, auch in München, Berlin und Wuppertal/Köln, darüber hinaus seit Juni dieses Jahres erfreulicherweise auch eine Anlaufstelle in Wien, die sich aus dem dortigen »Prekär-Café« und unserer grenzüberschreitenden Kooperation entwickelt hat und sogar vom österreichischen Gewerkschaftsdachverband ÖGB getragen wird.
Was für eine Leistung bietet Migrar an? Was tut Ihr?
Wir beraten, wie der Untertitel auch sagt, »MigrantInnen in prekären Arbeitsverhältnissen, mit und ohne Papiere«. Das waren lange Zeit vor allem Menschen aus den 2004 und 2007 neu beigetretenen EU-Staaten, die zwar keine aufenthaltsrechtlichen Probleme, aber Probleme am Arbeitsplatz hatten, weil Deutschland die Arbeitnehmerfreizügigkeit eingeschränkt hatte und diese EU-BürgerInnen hier nicht regulär angestellt arbeiten durften. Es ging uns aber auch um Menschen aus sog. »Drittstaaten«, die aufgrund ihres Aufenthaltsstatus‘ Probleme hatten, ihren Lebensunterhalt zu sichern, weil sie in ihren Arbeitsverhältnissen einer besonderen Erpressbarkeit ausgesetzt sind – z.B. abgeschoben werden können, wenn sie sich gegen ihre Auftrag- und Arbeitgeber wehren. Wir haben immer gesagt: Entscheidend für die Betroffenen und für uns als BeraterInnen ist die Illegalität des Arbeitsverhältnisses, nicht der Aufenthaltstitel, denn an der faktisch erbrachten Arbeitsleistung setzt der Rechtsanspruch und damit der Beratungsbedarf an: Jede erbrachte Arbeitsleistung zählt als Arbeitsvertrag, ob schriftlich, mündlich oder stillschweigend zustande gekommen. Dementsprechend beraten wir zurzeit all diejenigen, die zu uns kommen, weil ihnen gesetzlich oder tariflich zustehende Löhne oder der jeweilige Mindestlohn nicht oder nicht vollständig gezahlt werden, weil ihnen aus ihrem Arbeitsverhältnis heraus zustehende sozialrechtliche Ansprüche wie z.B. Krankengeld, Urlaub, Kündigungsschutz etc. nicht gewährt werden – ober eben, wenn sie einen Arbeitsunfall hatten und dann feststellen, dass ihr Arbeitgeber sie nicht angemeldet hat und sie krank vor dem Nichts stehen.
Wie kam es dazu? Wie kam die Idee zustande?
Die Idee dazu gab es schon seit etwa Anfang 2000, als wir uns im Rahmen einer Arbeitsgruppe zu prekärer Beschäftigung in der express-Redaktion und bei »kmii« mit den Ansätzen der US-amerikanischen »Workers Centers« beschäftigt hatten. Die haben sich in den USA als unabhängige Organisierungsansätze aus der MigrantInnenarbeit heraus entwickelt, weil MigrantInnen dort nicht zuletzt aufgrund der traditionell arbeitgeberfreundlichen Gesetzgebung und der schlechten Position der Gewerkschaften besonders wenig Schutz und auch Organisierungsmöglichkeiten hatten. Nachdem MigrAr Hamburg gegründet worden war und wir auch für das Rhein-Main-Gebiet einen entsprechenden Bedarf konstatiert haben, sind wir an ver.di und DGB herangetreten mit der Idee, im ersten Schritt eine gewerkschaftliche Anlaufstelle für prekär beschäftigte MigrantInnen zu gründen, denen wir arbeitsrechtliche Erstberatung und Unterstützung bei der Durchsetzung ihrer Rechte anbieten. Unser Ziel ist aber immer noch, die Idee der (Selbst-)Organisierung von MigrantInnen voranzutreiben. Jede Beratung ist nur so gut, wie sie sich selbst überflüssig machen kann, oder anders gesagt: wie unsere KlientInnen lernen, sich selbstständiger zu bewegen und gemeinsam mit anderen am Arbeitsmarkt zu behaupten. Gute Ansätze dazu haben wir z.B. in München gesehen, wo sich Hunderte BulgarInnen in ver.di organisiert hatten. Wir haben die Münchener KollegInnen auch nach Frankfurt eingeladen, um in der hiesigen Community von ihren Erfahrungen zu berichten, Mut zu machen und Aufklärungsarbeit zu leisten. Etwas Ähnliches hatten wir auch mit Au Pairs und Haushaltshilfen gemacht und haben es für andere Berufsgruppen vor.
Dürfen nur Gewerkschaftsmitglieder zu Euch kommen zur Beratung?
Nein, der Clou von MigrAr ist gerade, dass die KollegInnen gewerkschaftliche Ansprechpartner finden, auch wenn sie noch nicht organisiert sind. Unternehmen haben im Rhein-Main-Gebiet zig Möglichkeiten, Informationen und Beratung zu erhalten. Für ArbeitnehmerInnen aus den südeuropäischen Krisenländern, aus Osteuropa und schon gar für Flüchtlinge, Geduldete oder AsylbewerberInnen gibt es viel zu wenig. Viele haben in ihren Herkunftsländern schlechte Erfahrungen mit Staatsgewerkschaften und deren Nachfolgern gemacht, jüngere KlientInnen wissen oft gar nicht, was eine Gewerkschaft ist. Die Leute brauchen zunächst jemanden, der ihnen vertraut und dem sie vertrauen können. Oft hilft es ihnen schon, wenn wir als offizielle gewerkschaftliche Stelle uns bei Konflikten mit den Arbeitgebern einschalten und Geltendmachungen mit ihnen schreiben. Wenn es juristisch ernst wird, empfehlen wir dann eine Gewerkschaftsmitgliedschaft und vermitteln an die zuständigen Einzelgewerkschaften.
Wer kommt zu Euch, was sind das für Menschen?
Es hat ein bisschen gedauert, bis MigrAr sich herumgesprochen hatte. Anfänglich hatten wir es vor allem mit polnischen und ungarischen Kollegen zu tun, die hier als Saisonkräfte in der Landwirtschaft oder als scheinselbstständige »Fliesenleger« gearbeitet hatten. Es sind im Übrigen oft solche Berufe, für die der Meisterzwang im Zuge der Liberalisierung und gezielten Wettbewerbsförderung abgeschafft wurde, in denen es die größten Probleme mit Werkverträgen und Scheinselbstständigkeit gibt.
Von MigrantInneninitiativen und aus den kirchlichen Anlaufstellen wurden uns dann aber auch Frauen aus Lateinamerika, Indonesien oder von den Philippinen vermittelt, die als sog. Haushaltshilfen in Privathaushalten gearbeitet haben und komplizierte Probleme mit ihrem Aufenthaltsstatus, persönlicher Abhängigkeit vom »Arbeitgeber« und z.T. auch Gewalterfahrungen hatten. Die Schwierigkeit ist hier: Wie sollen diese Frauen etwas beweisen? Es gibt oft keine ZeugInnen für das, was ihnen passiert. Das Opferschutzgesetz ist hier einfach noch nicht weit genug, um diesen Frauen wirklich Mut zu machen, sich zu wehren – sie riskieren immer noch die Abschiebung.
Im Rhein-Main-Gebiet haben wir es aber nach unserer Beobachtung vor allem mit Werkvertrags-Arbeitern zu tun – die Polizei schätzt, dass es 10 000 bis 12 000 Scheinselbstständige hier gibt. Dazu gehörten z.B. zwei bulgarische Kollegen und ein Kolumbianer mit spanischer Staatsangehörigkeit, die wir vertreten haben. Zusammen hatten sie für einen spanischen Subunternehmer mit deutscher Staatsangehörigkeit aus dem Frankfurter Gallusviertel im Auftrag eines Augsburger Bauunternehmers eine Mehrzweckhalle für Rossmann, Takko Fashion u.a. in einem Gewerbegebiet bei Nürnberg hochgezogen – ein quasi »glokales« Projekt. Auftraggeber war übrigens die Kommune – das zeigt schon, wie falsch die üblichen Schuldzuweisungen sind. Den Kollegen fehlten 3 500 Euro, die ihnen nach Bau-Mindestlohn zugestanden hätten. Nach dem Arbeitsgerichtsurteil, das wir für die Kollegen erreicht haben, tauchte der Inhaber des »Hausmeister & Reinigungs-Service« aus dem Gallus unter, der Augsburger Geschäftsmann meldete Insolvenz an. Die Kollegen mussten sich schließlich mit 550 Euro Insolvenzgeld für sechs Wochen Arbeit an sechs Tagen die Woche, mit täglichen Arbeitszeiten von bis zu 12 Stunden begnügen – gezahlt letztlich aus Mitteln der Arbeitsagentur. Hier könnte man mal mit den Unternehmerverbänden und den politisch Verantwortlichen analysieren, wer eigentlich den sogenannten »Sozialmissbrauch« betreibt.
Bedenklich ist: Auch nach dem 1. Januar 2014 kommen immer noch viele bulgarische und rumänische KollegInnen, die hier als Entsendebeschäftigte oder als Scheinselbstständige »über«ausgebeutet werden – obwohl sie seitdem direkt in Deutschland arbeiten und regulär hier angestellt werden dürften. Immer wieder erzählen sie uns, dass sie viel lieber sozialversichert arbeiten würden und auch bereit wären, ihre Beiträge an die Sozialversicherungen und das Finanzamt zu leisten. Doch die Unternehmen mauern und verlangen den Gewerbeschein – oder sie finden nur etwas bei Leiharbeitsfirmen oder auf Mini-Job-Basis. Das geht quer durch die Branchen und betrifft im Übrigen vermehrt auch KollegInnen aus Spanien, Italien und Portugal, die oftmals gut qualifiziert sind. Hier findet ein gewaltiger Entwertungsprozess qualifizierter Arbeit statt, der letztlich auch die ArbeitsinländerInnen betrifft. Neulich haben wir z.B. eine osteuropäische Ärztin beraten, die hier in einer Praxis als Arzthelferin angestellt und von der Praxisinhaberin noch innerhalb der Probezeit gekündigt wurde. Bis heute hat sie keinen Arbeitsvertrag gesehen – und das magere Gehalt, das ihr versprochen wurde, auch nicht. Dagegen haben wir jetzt mit Fristsetzung Geltendmachungen geschrieben. Glücklicherweise gab es hier viele ZeugInnen, die die Arbeitstätigkeit bestätigen können. Das ist bei vielen unserer KlientInnen nicht so – die Angst, selbst Jobs zu verlieren, die kein Inländer mehr übernehmen würde, macht Solidarität unter den KollegInnen schwer. Die meisten sind am Ende auf sich selbst gestellt. Deswegen raten wir allen immer, Stundenzettel zu führen, auf Quittungen zu beharren, Fotos von ihren Einsatzorten und Firmen zu machen und bei Gesprächen mit Vorgesetzten immer KollegInnen mitzunehmen. Das wissen sie dann für‘s nächste Mal, doch wenn sie zu uns kommen, ist das Kind oft schon in den Brunnen gefallen – gerade im Baubereich sind die Projekte meist abgeschlossen, und die KollegInnen haben sich schon zigmal von ihren Vorarbeitern oder Chefs vertrösten lassen, bevor sie aktiv werden und sich an uns wenden.
Wie unterhaltet Ihr Euch mit den Leuten?
Ein heikler Punkt. Das Sprachproblem ist eine der größten Hürden, viele KlientInnen sprechen nur wenig Deutsch. Unsere Info-Flyer sind zwar in zwölf Sprachen übersetzt, aber bei den BeraterInnen gibt es zur Zeit nur Englisch, Französisch und Spanisch. Das reicht nicht, um sich mit Menschen aus dem Kosovo, Ungarn, Polen, Rumänien, Bulgarien etc. verständigen zu können. Wir haben einige ehrenamtliche UnterstützerInnen, die türkisch, Farsi und portugiesisch sprechen und die wir bei Bedarf anrufen, um dann einen Extra-Termin auszumachen. Das geht aber oft nur in deren Freizeit, denn die KollegInnen sind ja auch berufstätig. Außerdem kooperieren wir mit unserer Schwester-Organisation vom DGB-Projekt »Faire Mobilität«, das bundesweit sechs Anlaufstellen mit unterschiedlichen Branchen- und Sprachschwerpunkten hat, eine davon in Frankfurt im Bau- und Reinigungsbereich. Dort arbeiten eine polnisch- und eine rumänischsprachige Kollegin, die wir um Hilfe bitten können. Im Berliner »Beratungsbüro für entsandte Beschäftigte« sitzt eine Arbeitsrechtlerin und ehemalige Kollegin von uns, die bulgarisch spricht und mit der wir telefonieren, wenn wir gar nicht weiter kommen – nun ist noch eine bulgarischsprachige Kollegin bei »Faire Mobilität« in Dortmund hinzugekommen. Also immerhin zwei Personen bundesweit, die die benötigten Kompetenzen haben und diese Sprache sprechen… Manchmal müssen wir Telefonketten quer durch die Bundesrepublik bilden, um uns mit unseren KlientInnen so verständigen zu können, dass die komplizierten Details zu arbeits-, aufenthalts- und sozialrechtlichen Ansprüchen klärbar sind. Wir haben keinen Etat für Dolmetscher. Auch deswegen fordern wir dringend mehr öffentliche Unterstützung, z.B. kommunale ÜbersetzerInnenpools, die von Beratungsorganisationen genutzt werden können. Aus unseren Gesprächen mit den anderen Beratungsstellen aus dem gewerkschaftlichen und kirchlichen Bereich wissen wir: Keine Organisation, egal wie gut sie institutionell abgesichert ist, kann all die Sprachen vorhalten, die benötigt werden – und selbst die beste sozialarbeiterische Ausbildung mit Diversity-Trainings und interkulturellem Kompetenzerwerb nützt nichts, wenn die nächste Krise, der nächste Krieg neue Zuwanderer aus neuen Regionen bringt. Das hat im Übrigen auch eine Studie gezeigt, die das ISS (Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik) im Auftrag der Stadt Frankfurt durchgeführt hat: Alle ExpertInnen waren sich einig in der Notwendigkeit eines öffentlich finanzierten Dolmetscher-Pools.
Was unterscheidet Euch von der Beratungsstelle für mobile Beschäftigte des DGB, »Faire Mobilität«?
Faire Mobilität wird als DGB-Projekt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des DGB gefördert, in Frankfurt ist es aus dem Europäischen Verein für Wanderarbeiterfragen hervorgegangen, der von der IG BAU gegründet wurde. Daraus erklärt sich der aktuelle Beratungsschwerpunkt im Bau- und Reinigungsbereich. Im Unterschied zu MigrAr sind die KollegInnen von Faire Mobilität fest angestellt und werden für die Arbeit bezahlt. MigrAr arbeitet dagegen komplett ehrenamtlich.
Nachdem Faire Mobilität 2011 mit dem Ziel einer besseren Vertretung von grenzüberschreitend tätigen Entsendebeschäftigten aus Mittel- und Osteuropa gegründet wurde, haben wir mit den KollegInnen hier vor Ort eine Arbeitsteilung besprochen: Solange es dieses bis Herbst 2015 befristete Projekt gibt, kümmert MigrAr sich stärker um Drittstaatsangehörige und Menschen aus dem Pflege-, Logistik- oder Gastronomiebereich – Branchen, in denen sich neben Bau und Reinigung die härtesten Fälle von Arbeitsausbeutung konzentrieren. Danach sehen wir weiter. In der Praxis sind die Grenzen jedoch sowieso fließend. Wenn wir z.B. eine rumänische Staatsangehörige haben, die schon mehrere Jahre in Italien und Spanien gearbeitet hat und nun in Deutschland bei einer Zeitarbeitsfirma landet, die sie an einen Zulieferer eines Pharmaunternehmens in Darmstadt verleiht, um giftige Chemikalien umzufüllen und zu verpacken, was ist das dann für eine Branche, wer ist zuständig? Und wenn diese Frankfurter Zeitarbeitsfirma ihr auch noch einen Aufhebungsvertrag unterjubeln möchte, der das Arbeitsverhältnis just einen Tag vor dem ärztlich attestierten Beschäftigungsverbot wegen extremer gesundheitlicher Beeinträchtigungen und Schwangerschaft enden lässt, um sich so aus der Verantwortung für den gesetzlich verankerten Mutterschutz zu stehlen, dann müssen wir sowieso all unsere Kompetenzen zusammenschmeißen, um diesen Fall zu klären. Hinzu kommt: Angesichts der zunehmenden Phantasie der Unternehmen bei der Umgehung von Arbeits- und Sozialrechten – vor allem nach der Einführung des Mindestlohns für Zeitarbeit – sehen beide Anlaufstellen sich mit steigenden Fallzahlen konfrontiert. Es klingt zwar toll, dass es in Frankfurt zwei Anlaufstellen gibt, doch schon jetzt stoßen unsere BeraterInnen – egal ob befristet finanziert wie bei Faire Moblität oder ehrenamtlich wie bei MigrAr – an ihre Grenzen. Der Bedarf ist viel höher als unsere Kapazitäten, und wir gehen davon aus, dass er weiter steigen wird. Wenn diese Beratungsarbeit nicht finanziell abgesichert und ausgebaut wird und abhängig Beschäftigte nicht mindestens die gleichen Informations- und Beratungsangebote erhalten wie Firmen, leiden darunter nicht nur unmittelbar unsere KlientInnen, sondern das hat Konsequenzen für alle Beschäftigten.
Wie bist Du qualifiziert für diesen Job?
Mit den Zusammenhängen zwischen dem ›Testfeld‹ Arbeitsmigration und den Veränderungen der Arbeitsverhältnisse von sogenannten ArbeitsinländerInnen – Stichwort Prekarisierung – beschäftige ich mich als Sozialwissenschaftlerin schon lange. Seit etwa 15 Jahren bieten wir dazu auch Seminare in der politischen Bildungsarbeit von ver.di bzw. vorher der ÖTV an. Vieles, was uns in der Beratungspraxis begegnet, erfordert jedoch »Learning by Doing«. Hier bündeln sich Probleme aus dem Arbeits-, Sozial- und Ausländerrecht, man braucht Kenntnisse über EU- und aufenthaltsrechtliche Regelungen für unterschiedliche MigrantInnengruppen. Dazu gibt es aber auch Schulungsangebote des Projekts Faire Mobilität, die wir als BeraterInnen bei MigrAr nutzen. Trotzdem: Man kommt aus dem Staunen nicht heraus, wie erfinderisch Firmen agieren, um sich aus der Verantwortung zu stehlen. Hier lernt man mit jedem Fall dazu, denn es gibt immer neue Tricks – von vermeintlichen Barabschlägen, die unsere KlientInnen nie erhalten haben, die aber auf Rechnungen auftauchen, die sich die Unternehmen im Namen unserer KlientInnen selbst ausstellen, bis zu willkürlichen Abzügen für angebliche Qualitätsmängel, Verpflegung, Unterkünfte und dubiose Dienstleistungen. Jüngst hatten wir z.B. eine solche Rechnung, in der der Firmeninhaber sich 20 Prozent »Steuerabschlag« genehmigt hat – unser kolumbianischer Klient war erst kurz hier und noch nicht einmal beim Finanzamt gemeldet. Manchmal muss man auch gegen behördliche Windmühlen kämpfen, gerade wenn es um die Durchsetzung sozialrechtlicher Ansprüche unserer KlientInnen geht. Es kann im Einzelfall ganz schön schwer sein, einen ALG II-Anspruch oder Prozesskostenhilfe durchzusetzen, wenn die KollegInnen ihre Arbeit verlieren, aber keinerlei Nachweise über ihre Einkommen führen können, von ihren Auftraggebern nur gefakte Verträge erhalten oder von ihren Vermietern keine Quittungen bekommen. Hier braucht man vor allem eins: Steherqualitäten im Sprint gegen die Zeit, die unseren KlientInnen oft wegläuft, Fingerspitzengefühl bei Ämterbegleitungen und politisch einen langen Atem, damit die Rahmenbedingungen sich ändern. Der Rest ist Kooperationsfähigkeit und ein gutes Unterstützernetzwerk.
Was war bisher Dein eindrücklichstes Erlebnis bei der Beratung?
Das kann ich gar nicht so eindeutig sagen: sicher jeder einzelne Moment, in dem es gelingt, trotz scheinbar aussichtsloser Lage doch noch etwas herauszuholen für die Menschen, die zu uns kommen, egal ob das eine verhinderte Kündigung, das Eintreiben von Krankengeld oder eine 1 500-Euro-Lohnforderung ist. Aus der jüngsten Beratungserfahrung aber auch der Frust, als klar war, dass ein Kosovare, der aus dem 4. Stock auf die Straße gestürzt war, weil das Baugerüst nachgegeben hat, keinen Cent von seinen Auftraggebern, einer Frankfurter Gerüstbaufirma, erhalten wird. Die hatten im Krankenhaus, während er im Koma lag, eine falsche Geschichte erzählt, auf die sich die Berufsgenossenschaft dann gestützt hat. Bis er aus dem Koma aufgewacht war, uns vertraut hat, sich erinnern konnte und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft eine Scheinselbstständigkeit tatsächlich belegt haben, waren alle wichtigen Fristen verstrichen – und sein Kollege weigerte sich, den tatsächlichen Hergang zu bezeugen, um so wenigstens zivilrechtliche Ansprüche wegen des fehlenden Lohns durchzusetzen. Während sein Auftraggeber mit einer Geldstrafe von 2 700 Euro wg. illegaler Beschäftigung davon kam, ist Herr S. abgeschoben worden und wird vermutlich sein Leben lang arbeitsunfähig bleiben. Das ist bitter und kann einen sehr wütend machen.
Was war Dein größtes Erfolgserlebnis?
Vielleicht tatsächlich der Moment, als ich mit einem im Industriepark Höchst verunfallten Klienten aus dem Uniklinikum kam und klar war, dass er nach monatelangem Ringen endlich eine Kostenzusage und einen Operationstermin hatte. Da haben wir ein bisschen fassungslos in der Sonne am Mainufer gestanden und erstmal ein paar Tränen verdrückt. Teils aus Erleichterung, teils aber auch, weil das wirklich ein hartes Stück Arbeit war. Eine OP durchzusetzen wäre streng genommen gar nicht unser Job bei MigrAr gewesen, für die medizinische Betreuung und für die Durchsetzung sozialrechtlicher Ansprüche gibt es eigentlich andere Strukturen in der Stadt, die aber in diesem Fall nicht so funktioniert haben, wie man sich das wünschte.
Ein Erfolgserlebnis ist aber im Grunde auch jedes Gespräch mit KollegInnen aus anderen Beratungsorganisationen, aber auch MitarbeiterInnen von Sozialbehörden oder Jobcentern, die sich nicht von der Debatte um eine angebliche Armutszuwanderung und nicht belegbaren Sozialleistungsmissbrauch irre machen lassen, Verständnis für die Problemlage unserer KlientInnen haben und sich für deren Rechte einsetzen. Und natürlich, wenn es gelingt, neue KollegInnen für die Mitarbeit bei MigrAr zu gewinnen – und wenn wir feststellen, dass sich unsere KlientInnen mit der Idee gewerkschaftlicher Solidarität anfreunden.
Was wäre aufgrund Deiner Erfahrung bei der Beratung wichtig bei einem Tariftreue- und Vergabegesetz?
Ein wirksamer Schutz für diejenigen, die am unteren Ende der Vergabekette stehen, also Werkverträgler und illegal überlassene LeiharbeiterInnen. Sie können sich nur wehren, wenn nicht ihnen, sondern ihren Auftraggebern – und das heißt in Konsequenz den Generalunternehmern – die Beweislast auferlegt wird, wie das jüngst auch zwei ProfessorInnen, Peter Schüren und Christiane Brors, in einem Gutachten für die nordrhein-westfälische Landesregierung gefordert haben. Die aktuelle Fassung des schwarz-grünen Gesetzesvorhabens in Hessen dagegen macht alles zunichte, was wir bislang noch in der Hand hatten bei der Generalunternehmerhaftung, indem es auch den Nachunternehmer in die Nachweispflicht für die Einhaltung tariflicher Regelungen nehmen und haftbar machen will. Doch das sind genau unsere KlientInnen. Was sollen die machen, wenn jeder Auftraggeber in der Kette sein unternehmerisches Risiko mit Unbedenklichkeitsbescheinigungen und gefakten Dokumenten auf den nächsten Subunternehmer und damit auf sie abwälzt?
Wenn man den ruinösen europaweiten Dumping-Wettbewerb mit seinen menschlichen und sozialen Begleitkatastrophen verhindern statt anheizen will, braucht es dafür in Konsequenz auch eine konsequente Ergänzung der Generalunternehmerhaftung um die Sozialversicherungspflicht, deren Ausweitung auf alle Branchen und die Abschaffung von Werkverträgen und Leiharbeit. Equal Pay, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort, und Sozialversicherungspflicht für alle abhängig Beschäftigten und Einkommensgruppen unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus – dann müsste die Gesellschaft nicht permanent die externen Kosten für einen Preiswettbewerb tragen, der seriöse Kalkulationen gar nicht mehr zulässt, sondern finsterste Formen illegaler Beschäftigung von vornherein einkalkuliert – zum Beispiel die 1,09 Euro, die beim »Sky Plaza« im schicken Frankfurter Europaviertel gezahlt wurden. Es ist absurd: Die Regierung hält ImmigrantInnen aus Elends- und Krisenregionen ab und erlaubt den Unternehmen hier, zu eben diesen Bedingungen zu produzieren.
Wie kann man Kontakt zu Euch aufnehmen? Wie oft seid ihr erreichbar in der Woche?
Wir haben zwei Mal im Monat öffentliche Sprechzeiten, wegen der unterschiedlichen Arbeits- und Schichtzeiten potentieller KlientInnen versetzt: jeden ersten Donnerstag von 9-11 Uhr und jeden dritten Donnerstag von 17-19 Uhr. Erreichen kann man uns am besten per Email: kontakt@migrar-ffm.de. Darüber hinaus kann man in dringenden Fällen Termine außerhalb der Sprechzeiten vereinbaren.
Das Interview führte Ute Fritzel, ver.di Landesbezirk Hessen; gekürzt veröffentlicht unter: https://hessen.verdi.de/ ![]()
| ver.di zum Tariftreue- und VergabegesetzDie Gewerkschaft ver.di fordert die Parteien im hessischen Landtag auf, für ein wirksames Tariftreue- und Vergabegesetz zu sorgen. Am 11. September findet dazu eine Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Landtages statt. ver.di-Landesbezirksleiter Jürgen Bothner: »Wir begrüßen es, dass die schwarz-grüne Landesregierung sich beim Thema Vergabe bewegt. Das zeigt sich schon darin, dass in dem Fraktionsentwurf von Grünen und CDU der Öffentliche Personen-Nahverkehr, ÖPNV, mit aufgenommen wurde. Allerdings muss in diesem Punkt nach unserer Auffassung deutlich nachjustiert werden. Das Gesetz darf nicht zum zahnlosen Papiertiger werden.«So sollte der Tarifvertrag, der einer Tariftreueregelung im ÖPNV zugrunde gelegt wird, nach Auffassung von ver.di repräsentativ sein. Der Beirat, der sich damit beschäftigt, sollte aus Vertretern der Tarifparteien des ÖPNV zusammengesetzt sein.
Darüber hinaus kritisiert Bothner, dass im Entwurf von Grünen und CDU die Generalunternehmerhaftung gestrichen wurde. »Das lehnen wir strikt ab. Es verkehrt die Verhältnisse im konkreten Arbeitsleben. Denn dort sind es oft die nachgeordneten Subunternehmer, die hart arbeiten und dann um ihren Lohn betrogen werden. Müssen sie auch noch rechtlich die Verantwortung übernehmen, dann wird es völlig absurd.« Um gut zu funktionieren, so Bothner weiter, müsse ein Tariftreue- und Vergabegesetz über eine effektive Kontrollinstanz verfügen. Diese müsse auch befugt sein, bei Verstößen Sanktionen auszusprechen. Bothner: »Ein Unternehmer, der keinen Tariflohn bezahlt und die sozialen Standards nicht einhält, könnte dann auf Zeit oder länger von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden.« Schließlich spricht sich ver.di dafür aus, den Schwellenwert von 10 000 Euro im Entwurf zu streichen. Bothner: »Das Gesetz wirkt breiter, wenn es grundsätzlich gilt und nicht erst bei Aufträgen ab 10 000 Euro.« Quelle: ver.di-Pressemitteilung vom 11.09.2014 |


