Ausstellung «40 Jahre Kampf um die 35-Stunden-Woche»: Leben, Lachen, Lieben, Kämpfen
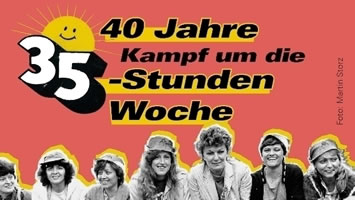 „Dienstag 14. Mai 2024 – Im Stuttgarter Gewerkschaftshaus treffen sich Aktivist:innen aus dem Streik vor 40 Jahren. Veranstalterin ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg. (…) Es ist eine Handvoll ehemaliger Aktiver, die die Idee für die Veranstaltung umsetzen. Neben dem umtriebigen »Rosa-Lux«-Büro, Christa Schnepf und Martin Storz, die den Streik fotografisch für die IGM- Streiknachrichten begleiteten und ihre beeindruckenden Aufnahmen für eine Fotoausstellung zur Verfügung stellten (Klasse Gestaltung: Filippo Capezzone). Heidi Scharf, 1984 IGM-Gewerkschaftssekretärin in Heilbronn, mit einem launigen Beitrag zur Historie des Kampfes um die 35-Stunden-Woche und ich mit einem Bühnenprogramm, das die Stimmung und die kulturelle Durchdringung des damaligen Arbeitskampfes mit Live-Musik, Texten, Projektionen, Einspielern und Tondokumenten widerspiegelt, wozu ich neben Musikern aus dem ewo2-Projekt auch kulturell Aktive von damals, wie Margit Romeis oder Einhart Klucke gewinnen kann…“ Bericht des Liedermachers Bernd Köhler vom 13. Januar 2025 beim gewerkschaftsforum.de
„Dienstag 14. Mai 2024 – Im Stuttgarter Gewerkschaftshaus treffen sich Aktivist:innen aus dem Streik vor 40 Jahren. Veranstalterin ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg. (…) Es ist eine Handvoll ehemaliger Aktiver, die die Idee für die Veranstaltung umsetzen. Neben dem umtriebigen »Rosa-Lux«-Büro, Christa Schnepf und Martin Storz, die den Streik fotografisch für die IGM- Streiknachrichten begleiteten und ihre beeindruckenden Aufnahmen für eine Fotoausstellung zur Verfügung stellten (Klasse Gestaltung: Filippo Capezzone). Heidi Scharf, 1984 IGM-Gewerkschaftssekretärin in Heilbronn, mit einem launigen Beitrag zur Historie des Kampfes um die 35-Stunden-Woche und ich mit einem Bühnenprogramm, das die Stimmung und die kulturelle Durchdringung des damaligen Arbeitskampfes mit Live-Musik, Texten, Projektionen, Einspielern und Tondokumenten widerspiegelt, wozu ich neben Musikern aus dem ewo2-Projekt auch kulturell Aktive von damals, wie Margit Romeis oder Einhart Klucke gewinnen kann…“ Bericht des Liedermachers Bernd Köhler vom 13. Januar 2025 beim gewerkschaftsforum.de ![]() – siehe mehr daraus und zur Veranstaltung:
– siehe mehr daraus und zur Veranstaltung:
- Weiter aus dem Bericht des Liedermachers Bernd Köhler vom 13. Januar 2025 beim gewerkschaftsforum.de
 : „… Mit Einhart, Margit und anderen war ich im Vorfeld des damaligen Streiks mit der Revue »Es gibt ein Leben vor der Rente« eineinhalb Monate durch die Republik getourt. In Gewerkschaftshäusern, Bürgersälen oder vor Betriebsversammlungen brachten wir einen heißen Ritt durch die Geschichte der Arbeiterbewegung auf die Bühne, der mit der Forderung nach der 35 endete. Es war keine offizielle Tour der IG Metall und vielleicht ergab sich auch der Erfolg und die Intensität der Aufführungen daraus, dass die örtlichen Gewerkschaften aus eigenem Antrieb auf diese kulturelle Unterstützung gesetzt und und uns engagiert hatten. Die Erfahrung mit Kultur in gewerkschaftlichen Kämpfen hatte damals schon einen längeren Vorlauf, war aus der Politisierung seit den 60er Jahren erwachsen, als viele Gewerkschaftsmitglieder nicht nur durch die betriebliche Wirklichkeit, sondern auch über außerparlamentarische Aktivitäten (selbstverwaltete Jugendzentren, Aktionen gegen Rechts, Anti-AKW-Bewegung) oder linkspolitische Organisationen zur Gewerkschaftsarbeit kamen. So auch wir Kulturleute. Und es waren kluge Gewerkschafter:innen, die uns damals den Weg in die Organisation öffneten, allen Vorbehalten und Widerständen zum Trotz. (…) »Damals waren Kulturschaffende und Musiker:innen an unserer Seite. (…) Der Streik begann im Regen und endete nach vielen Wochen im Regen. Schlecht für die Stimmung. Was wäre gewesen, wenn nicht Lieder und Musikant:innen für gute Laune gesorgt hätten, zum Mut machen, zum Aufheitern, zum Mitsingen, aber auch, um dem Bedürfnis nach Schulterschluss und Solidarität musikalischen Ausdruck zu verleihen. In den langen Streikwochen wurde vieles wieder und vieles neu gelernt. Eine ganz wichtige Rolle spielten bei diesem Lernprozess unsere ausländischen Kolleginnen und Kollegen. Italienische, türkische und griechische Lieder gehörten zum Repertoire unserer Liedermacher:innen und Songgruppen, Texte machten die Runde und irgendwann wurden diese Lieder mitgesungen von allen – auch den Deutschen. Das war eine wunderbare gemeinsame Erfahrung.«, schrieb Sybille Stamm in einem Nachklang zum Streik. (…) Diese fruchtbare Beziehung endete und hinterließ Ernüchterung, als nach sieben Wochen Streik der umstrittene Etappenplan zur Einführung der 35-Stunden des Schlichters Georg Leber, abschätzig LeberKäs genannt, verabschiedet wurde. (…) 40 Jahre danach findet die Ernüchterung ihre Fortsetzung. Die offizielle Erinnerungsarbeit an diese bedeutende Zeit bundesdeutscher Gewerkschaftsbewegung fand auf äußerster Sparflamme statt. Die damalige Haltung und inhaltlichen Positionen passten nicht in das allgemeine Wegducken gegenüber der mal wieder alles beherrschenden krisengeschüttelten Kapitallogik. Sowas hatte ich das letzte Mal Anfang der 90er Jahre erlebt, als nach dem Kollaps des realsozialistischen Modells auch der sozialkritische oder antikapitalistische Kulturansatz mit in den Strudel gerissen wurde. Die kämpferische Kultur und Historie der Arbeiter:innen-Bewegung mutierte auch in den Gewerkschaften zum Schamobjekt. Es folgte eine bleierne Zeit von rund zehn Jahren, nicht nur für die gewerkschaftliche Kultur, die erst durch den breiten außerparlamentarischen Widerstand gegen die Schrödersche HartzIV-Politik wieder aufgebrochen wurde.“
: „… Mit Einhart, Margit und anderen war ich im Vorfeld des damaligen Streiks mit der Revue »Es gibt ein Leben vor der Rente« eineinhalb Monate durch die Republik getourt. In Gewerkschaftshäusern, Bürgersälen oder vor Betriebsversammlungen brachten wir einen heißen Ritt durch die Geschichte der Arbeiterbewegung auf die Bühne, der mit der Forderung nach der 35 endete. Es war keine offizielle Tour der IG Metall und vielleicht ergab sich auch der Erfolg und die Intensität der Aufführungen daraus, dass die örtlichen Gewerkschaften aus eigenem Antrieb auf diese kulturelle Unterstützung gesetzt und und uns engagiert hatten. Die Erfahrung mit Kultur in gewerkschaftlichen Kämpfen hatte damals schon einen längeren Vorlauf, war aus der Politisierung seit den 60er Jahren erwachsen, als viele Gewerkschaftsmitglieder nicht nur durch die betriebliche Wirklichkeit, sondern auch über außerparlamentarische Aktivitäten (selbstverwaltete Jugendzentren, Aktionen gegen Rechts, Anti-AKW-Bewegung) oder linkspolitische Organisationen zur Gewerkschaftsarbeit kamen. So auch wir Kulturleute. Und es waren kluge Gewerkschafter:innen, die uns damals den Weg in die Organisation öffneten, allen Vorbehalten und Widerständen zum Trotz. (…) »Damals waren Kulturschaffende und Musiker:innen an unserer Seite. (…) Der Streik begann im Regen und endete nach vielen Wochen im Regen. Schlecht für die Stimmung. Was wäre gewesen, wenn nicht Lieder und Musikant:innen für gute Laune gesorgt hätten, zum Mut machen, zum Aufheitern, zum Mitsingen, aber auch, um dem Bedürfnis nach Schulterschluss und Solidarität musikalischen Ausdruck zu verleihen. In den langen Streikwochen wurde vieles wieder und vieles neu gelernt. Eine ganz wichtige Rolle spielten bei diesem Lernprozess unsere ausländischen Kolleginnen und Kollegen. Italienische, türkische und griechische Lieder gehörten zum Repertoire unserer Liedermacher:innen und Songgruppen, Texte machten die Runde und irgendwann wurden diese Lieder mitgesungen von allen – auch den Deutschen. Das war eine wunderbare gemeinsame Erfahrung.«, schrieb Sybille Stamm in einem Nachklang zum Streik. (…) Diese fruchtbare Beziehung endete und hinterließ Ernüchterung, als nach sieben Wochen Streik der umstrittene Etappenplan zur Einführung der 35-Stunden des Schlichters Georg Leber, abschätzig LeberKäs genannt, verabschiedet wurde. (…) 40 Jahre danach findet die Ernüchterung ihre Fortsetzung. Die offizielle Erinnerungsarbeit an diese bedeutende Zeit bundesdeutscher Gewerkschaftsbewegung fand auf äußerster Sparflamme statt. Die damalige Haltung und inhaltlichen Positionen passten nicht in das allgemeine Wegducken gegenüber der mal wieder alles beherrschenden krisengeschüttelten Kapitallogik. Sowas hatte ich das letzte Mal Anfang der 90er Jahre erlebt, als nach dem Kollaps des realsozialistischen Modells auch der sozialkritische oder antikapitalistische Kulturansatz mit in den Strudel gerissen wurde. Die kämpferische Kultur und Historie der Arbeiter:innen-Bewegung mutierte auch in den Gewerkschaften zum Schamobjekt. Es folgte eine bleierne Zeit von rund zehn Jahren, nicht nur für die gewerkschaftliche Kultur, die erst durch den breiten außerparlamentarischen Widerstand gegen die Schrödersche HartzIV-Politik wieder aufgebrochen wurde.“
Siehe zur Veranstaltung:
- 40 Jahre Kampf um die 35-Stunden-Woche: Ausstellungseröffnung und Kulturprogramm «Leben, lieben, lachen, kämpfen»
Einladung bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg zum Gewerkschaftshaus, Willi-Bleicher-Haus (gr. Saal) in Stuttgart am 14.05.2024, 18:00 – 22:00 Uhr
zum Gewerkschaftshaus, Willi-Bleicher-Haus (gr. Saal) in Stuttgart am 14.05.2024, 18:00 – 22:00 Uhr - Siehe auch die Tagung: «40 Jahre Kampf um die 35-Stunden Woche. Ein Blick zurück nach vorn»
 am 29. Mai 2024
am 29. Mai 2024 - 1984 – Kampf um die 35-Stunden-Woche
Bilder und Bericht zur Ausstellungseröffnung vom 15.05.2024 bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg
bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg


