- Automobilindustrie
- Bauindustrie und Handwerk
- Chemische Industrie
- Elektro- und Metall(-Zulieferer)
- Elektrotechnik
- Energiewirtschaft (und -politik)
- Fahrzeugbau (Vom Fahrrad, über Trecker bis zum Flugzeug)
- Gewerkschaften als Arbeitgeber
- Holz, Papier, Glas und Kunststoffe
- Landwirtschaft und Gartenbau
- Lebens- und Genussmittelindustrie
- Maschinen- und Anlagenbau
- Medien und Informationstechnik
- Rüstungsindustrie und -exporte
- Sonstige Branchen
- Stahl-Industrie
- Stoffe und Bekleidung
- Abfall/Umwelt/Ver-/Entsorgung
- Banken und Versicherungen
- Bildungs- und Erziehungseinrichtungen
- Call-Center
- Dienstleistungen allgemein/diverse
- Gastronomie und Hotelgewerbe
- Gesundheitswesen
- Kultur und/vs Freizeitwirtschaft
- Öffentlicher Dienst und Behörden
- Reinigungsgewerbe und Haushalt
- Sex-Arbeit
- Soziale Arbeit, Kirche und Wohlfahrts-/Sozialverbände
- Sportwirtschaft
- Transportwesen: (Öffentlicher) Personen (Nah)Verkehr
- Transportwesen: Bahn
- Transportwesen: Hafen, Schiffe und Werften
- Transportwesen: Luftverkehr
- Transportwesen: Post- und Paketdienste
- Transportwesen: Speditionen und Logistik
- Wachdienste und Sicherheitsgewerbe
Verwaltung oder Politik des Lohns? Rudi Schmidt über neue Entgeltstrukturen im Einzelhandel
Artikel von Rudi Schmidt, erschienen in express, Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit, 05/2013
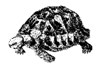 Im Einzelhandel läuft zurzeit eine Tarifrunde, die es in sich hat, denn zusätzlich zu den ohnehin schwierigen Gehaltsauseinandersetzungen hatten die Arbeitgeber den Manteltarifvertrag gekündigt. Das wird von vielen Beschäftigten und Hauptamtlichen an sich schon als Affront wahrgenommen. Dass dies auch ein Schachzug sein könnte, erneut ein letztlich (lohn)politisches Projekt auf die Tagesordnung zu setzen, das durch breite Diskussion und viele kritische Stimmen schon erledigt schien, steht dagegen weniger im öffentlichen Rampenlicht: Es geht um die Entgeltstrukturreform im Handel, die von Arbeitgeberverbänden, aber mit Blick auf ›veraltete‹, die Wirklichkeit der Arbeitsplätze und -aufgaben nicht mehr beschreibende Eingruppierungskriterien auch in einigen ver.di-Bereichen gefordert wird.
Im Einzelhandel läuft zurzeit eine Tarifrunde, die es in sich hat, denn zusätzlich zu den ohnehin schwierigen Gehaltsauseinandersetzungen hatten die Arbeitgeber den Manteltarifvertrag gekündigt. Das wird von vielen Beschäftigten und Hauptamtlichen an sich schon als Affront wahrgenommen. Dass dies auch ein Schachzug sein könnte, erneut ein letztlich (lohn)politisches Projekt auf die Tagesordnung zu setzen, das durch breite Diskussion und viele kritische Stimmen schon erledigt schien, steht dagegen weniger im öffentlichen Rampenlicht: Es geht um die Entgeltstrukturreform im Handel, die von Arbeitgeberverbänden, aber mit Blick auf ›veraltete‹, die Wirklichkeit der Arbeitsplätze und -aufgaben nicht mehr beschreibende Eingruppierungskriterien auch in einigen ver.di-Bereichen gefordert wird.
Längst überfällig wäre ein Blick auf Erfahrungen gewesen, die bei der Umstellung summarischer auf sog. analytische Arbeitsbewertungsverfahren in anderen Branchen, etwa der Chemie- oder zuletzt der Metallindustrie mit ihrem ERA-Vertrag, gemacht wurden. Ob der unbedingte Wille zu Modernität, der Nachweis tariflicher Anschluss- und Satisfaktionsfähigkeit gegenüber den Arbeitgebern oder schlicht das gehetzte Tagesgeschäft es nicht mehr zulassen, das historische Gedächtnis aufzufrischen oder gewerkschaftsübergreifende Lernerfahrungen zu ermöglichen – wir wissen es nicht.
Umso mehr freuen wir uns, dass Rudi Schmidt* im Folgenden eben jenen Blick zurück auf die Zielsetzungen analytischer Verfahren und auf die Erfahrungen mit der »Jahrhundertreform« ERA in der Metallbranche wirft – bevor die nächsten Fakten geschaffen werden. Der Beitrag geht zurück auf unsere Tagung »Innovative Tarifpolitik im Einzelhandel« am 15. September 2012, in der nächsten Ausgabe folgt das Co-Referat von Klaus Dörre.
Es gehört zu den Grundaufgaben der Tarifparteien, sich über die in den Betrieben anzuwendenden Lohnfindungssysteme und Entgeltstrukturen zu verständigen und sie von Zeit zu Zeit dem gesellschaftlichen und betrieblichen Wandel anzupassen. Seit vielen Jahren findet deshalb in Arbeitsgruppen von ver.di bzw. des Hauptverbands des deutschen Einzelhandels (HDE) eine Diskussion über die Modernisierung der jahrzehntealten Entlohnungsstrukturen statt. Ihre lange Dauer (seit 2003) weist schon darauf hin, dass die Materie nicht nur kompliziert, sondern auch kontrovers ist: Bei einer Modernisierung von Entgeltstrukturen handelt es sich ja nicht nur um eine Anpassung an veränderte objektive Gegebenheiten, sondern es findet gleichzeitig eine Neuaustarierung der Interessenpositionen statt. Denn Lohnfragen sind Verteilungsfragen und damit auch Machtfragen.
Um diese Gemengelage besser zu verstehen, muss kurz auf die Situation im Einzelhandel eingegangen werden. Überall im deutschen Einzelhandel gibt es seit Langem die Tendenz, die Lohnkosten zu verringern, sei es durch den verstärkten Einsatz un- und angelernter Arbeitskräfte, durch Tarifvermeidung und Lohnabsenkung oder durch Verlängerung und Flexibilisierung der Arbeitszeiten zu Lasten der Beschäftigten. Den Hintergrund dafür bildet die besondere Konkurrenzsituation des Einzelhandels. Da sein Umsatz an die Kaufkraftentwicklung gebunden ist und diese in den letzten zehn Jahren sich nur mäßig verbessert hat, können Umsatzsteigerungen nur durch Marktverdrängungen der Konkurrenten erreicht werden. Damit geht ein Konzentrationsprozess einher, der in Deutschland inzwischen dazu geführt hat, dass im Lebensmitteleinzelhandel 2008 die vier großen Anbieter Edeka (incl. Netto, Plus, Marktkauf), Rewe (incl. Penny, Kaufpark), die Schwarz-Gruppe (Lidl, incl. Kaufland, Handelshof) und Aldi (Aldi Nord und Aldi Süd) 85 Prozent des Umsatzes beherrschen (SZ v. 18. Februar 2011). Für den gesamten Einzelhandel kommt noch als big player die Metro-Gruppe hinzu; diese fünf bringen es zusammen auf ca. 75 Prozent.
Die Konkurrenz im Lebensmittelhandel wird dabei jeweils untereinander und zwischen den Discountern Aldi und Lidl auf der einen und den Vollsortimentern bzw. Supermarktketten Edeka und Rewe auf der anderen Seite ausgetragen. Das Vermarktungsprinzip der Discounter ist es, relativ wenige Produkte – 800 bis 1000 pro Laden – massenhaft und schnell umzuschlagen, das der Supermarktketten hingegen, ständig – je nach Verkaufsfläche – 30000 bis 50000 Artikel anzubieten und damit die Kunden zu längerem Verweilen und umfangreicheren Einkäufen anzuhalten. Das nötigt die Supermärkte nicht nur dazu, dreimal so viel Personal pro Fläche, sondern dabei auch mehr gelernte Verkaufskräfte vorzuhalten als die Discounter, die sich zumeist mit un- und angelernten (Regalauffüllern und KassiererInnen) begnügen.
Diese oligopolistische Konstellation beim Warenverkauf des kurzfristigen Bedarfs und insbesondere bei Lebensmitteln führt zu einer asymmetrischen Machtverteilung zwischen den Warenproduzenten und den Handelshäusern. Die Hersteller kommen um die ›Vierer-Bande‹ nicht herum und müssen sich vielfach deren Preisdiktat beugen. Dazu trägt bei, dass die Konsumgüterindustrie (im Jahr 2005) ca. 340000 Artikel im Angebot hat, die Regalflächen der Verkaufsmärkte aber begrenzt sind (Die Zeit v. 4. Mai 2005). Das erschwert den Markteintritt neuer Produzenten, denn der Zugang zu den Regalen muss von ihnen durch sogenannte »Listungsgelder« erkauft werden. Gleichzeitig muss das neue Produkt beworben werden, um in der angebotenen Warenfülle die Aufmerksamkeit des Kunden zu finden. Die hohen Kosten für Werbung und Listungsgeld waren z.B. für mittelständische Unternehmen in den neuen Bundesländern eine schwer zu überwindende Markteintrittsbarriere, weshalb für die dortige Handelsstruktur eine Konzentration größerer Anbieter bei geringerer Betriebsdichte charakteristisch ist.
Die Besonderheiten der Branche und die oben geschilderten Konkurrenzverhältnisse haben entsprechende Auswirkungen auf die Beschäftigungsverhältnisse, die Arbeitsbedingungen und die Lohnhöhe. Die geringe Wertschöpfung des Handels – es werden Waren eingekauft, gesammelt, verteilt und verkauft – führt zu einer niedrigen vertikalen Hierarchie in der Organisation und in den Entscheidungsstrukturen und erleichtert damit zentralistische Unternehmenskonzepte, wie sie ausgeprägt von den Eigentümern der beiden großen Discounterketten, den Familien Albrecht (Aldi Nord und Süd) und der Familie Schwarz (Lidl) praktiziert werden. Für eine Tätigkeit in diesem Bereich ist keine besondere Qualifikation erforderlich, eine kaufmännische Lehre genügt auch für den Aufstieg in Leitungspositionen. Das Gros der Beschäftigten ist in der Logistik und im Verkauf beschäftigt.
Wegen der geringen Rendite, die im Einzelhandel auf das Produkt bezogen erzielt wird, sind die Unternehmen bestrebt, möglichst viele Waren möglichst schnell umzuschlagen, was bei den Discountern besonders stark ausgeprägt ist. Die Umsatzrendite liegt im Lebensmitteleinzelhandel (Supermärkten u.ä.) bei 2 bis 2,5 Prozent, bei den nicht publizitätspflichtigen Familienunternehmen Lidl und Aldi vermutet man sie bei 4-6 Prozent. Die von der Kundschaft geschätzte Niedrigpreisstrategie der Discounter begünstigte deren Expansion, so dass diese bis Mitte des vergangenen Jahrzehnts auf über 40 Prozent Marktanteil kamen. Seitdem stagniert er, weil die Supermarktketten die Preiskonkurrenz mit ihren eigenen Handelsmarken aufnahmen und bei den Kunden wieder Boden gut machten. Diese starke Konkurrenz hat zumindest für die Konsumenten den Vorteil relativ niedriger Preise, wenn man sie mit dem Niveau anderer westeuropäischer Staaten vergleicht. Die Lebensmittelpreise liegen in Deutschland z.B. etwa 20 Prozent niedriger als in Frankreich. Dieser Vorteil wird mit dem gleichzeitig entstehenden Lohndruck zum Nachteil der Beschäftigten, während die niedrigen Preise die Albrechts nicht daran hinderten, Milliardengewinne aufzuhäufen.
Denn wo bei den Herstellern mit Preiszugeständnissen nichts mehr herauszuholen ist und die Verkaufspreise nur begrenzt steigerungsfähig sind, kann man nur noch die Lohnkosten senken; und von dieser Strategie wird im Einzelhandel in verschiedener Hinsicht seit Jahren Gebrauch gemacht. Es beginnt damit, unter Tarif zu zahlen. Dazu vermeiden die Unternehmen, sich durch Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband an den gültigen Branchentarif zu binden. Das ist im gesamten Handel verbreitete Praxis und zwar im Osten sehr viel mehr als im Westen. 2009 unterlagen dort nur 14 Prozent der Betriebe (im Westen 34 Prozent) und 24 Prozent der Beschäftigten (im Westen 48 Prozent) dieses Sektors einer tarifvertraglichen Regelung (WSI 2010: 114). Nicht nur der Lohn, sondern auch die Arbeitszeit, die Urlaubsregelung und vieles mehr lassen sich im Unternehmensinteresse abweichend gestalten.
Um darin freie Hand zu haben, sind viele große Einzelhandelsunternehmen bemüht, Gewerkschaften draußen zu halten und die Bildung von Betriebsräten zu verhindern. Das gelingt ihnen besser als in anderen Wirtschaftszweigen, weil die überwiegend weiblichen und Teilzeitarbeitskräfte nur wenig bereit sind, sich gewerkschaftlich zu organisieren und die Vereinzelung in den personalschwachen Filialen die Gründung von Betriebsräten erschwert. Als besonders mitbestimmungsfeindlich hervorgetan haben sich in der Vergangenheit die Discounter Lidl, Aldi Süd und die ehemalige Drogeriekette Schlecker. Bei Aldi Nord war man bemüht darum, dass die Gewerkschaft in den ab 1990 in den neuen Bundesländern errichteten Filialen gar nicht erst einen Fuß in die Tür bekam (SZ v. 8. April 2008). Der Wildwuchs bei den Arbeits- und Lohnbedingungen nahm zu, als die Arbeitgeber 2000 die Allgemeinverbindlichkeit ihrer Tarifverträge für die Unternehmen der Branche kündigten. Das hat sich besonders nachteilig auf die Lohnsituation der Beschäftigten im Einzelhandel ausgewirkt. Von den ca. 2,8 Mio. Beschäftigten in dieser Branche erhalten ca. 1 Mio. einen Stundenlohn unter 8,50 Euro, schätzt ver.di (ver.di-NRW 2012).
Die einfachste Form der Lohnsenkung ist der Personalwechsel. Man tauscht älteres gegen jüngeres Personal aus, Vollzeit- gegen flexible Teilzeitkräfte oder noch radikaler: Man entlässt regulär Beschäftigte und stellt sie als Leiharbeitskräfte zu niedrigerem Gehalt wieder ein, wie die Firma Schlecker es 2010 gemacht hat. Das gab einen gewerkschaftlichen Aufruhr und ist inzwischen schwieriger.
Daraus folgt, dass die Aushandlungssituation für die Gewerkschaftsseite eher ungünstig ist, da man von stark asymmetrischen Machtverhältnissen ausgehen muss. Erschwerend kommt hinzu, dass die Interessen im Unternehmerlager sehr heterogen sind – je nach Eigentumsverhältnissen, Vertriebsformen und Betriebsorganisation (also je nach Discountern, Supermarktketten, Besitzern von Kaufhäusern, Verbrauchermärkten oder SB-Warenhäusern, kleinen Selbstständigen etc.). Zwar hat sich die Beschäftigungssituation durch die günstige Konjunktur seit 2011 auch im Bereich des Einzelhandels verbessert und dadurch der Angebotsüberhang von Arbeitskräften etwas verringert, das ändert aber nichts an dem kleinbetrieblich bedingten Strukturproblem, d.h. der Vereinzelung in den Filialbetrieben und den vielen betriebsratsfreien Zonen. »2003 beschäftigten 73 Prozent der Unternehmen weniger als sechs Personen« (Kalkowski 2008: 11). Die asymmetrische Verhandlungssituation zwischen Arbeitgeberverband und Gewerkschaften dupliziert sich auf der Betriebsebene. Hier steht ganz überwiegend der einzelne Beschäftigte dem Unternehmer bzw. seinem beauftragten Management gegenüber, ohne Unterstützung einer ortsnahen Interessenvertretung. Da Entlohnung aber immer interessenbezogen strukturiert ist und in den Betrieben in den letzten Jahren ein immer höherer Leistungsdruck, stärkere Flexibilisierung etc. aufgebaut worden ist, sitzen die abhängig Beschäftigten bei allen Neuregulierungen am kürzeren Hebel.
In dieser Situation soll die Lohnfindung vom summarischen auf das analytische Arbeitsbewertungssystem umgestellt werden. Die summarische Grundlohnbestimmung ist das älteste und am weitesten in der deutschen Wirtschaft verbreitete Verfahren. Es verbindet qualifikatorische, also subjektive Elemente mit denen der Arbeitsplatzanforderungen, also objektiven Elementen und ist vergleichsweise grob gestaffelt. Viele Jahrzehnte vor und nach 1900 kannte man in den Betrieben nur drei Lohngruppen, nämlich für ungelernte, angelernte und qualifizierte Facharbeit. Insbesondere nach dem zweiten Weltkrieg kamen weitere Differenzierungen hinzu, die in manchen Branchen und Tarifgebieten, z.B. der Metallindustrie von Nordbaden-Nordwürttemberg, auf bis zu zwölf Lohngruppen ausgeweitet wurden. Faktisch waren es jedoch auch dort nur noch zehn, weil die untersten beiden im Betrieb kaum noch angewandt wurden. Einer der Haupteinwände – das summarische System erlaube keine hinreichende Differenzierung – lässt sich von daher nicht ganz bestätigen. Allerdings sind die qualifikatorischen Anforderungen im Einzelhandel im Allgemeinen geringer als in der technisch hochentwickelten Industrie. Hier kommt es in der Regel mehr auf die Bewältigung von einfachen technisch-administrativen, kalkulatorischen oder logistischen Anforderungen an. Auch für Leitungsfunktionen ist zumeist keine akademische Ausbildung erforderlich. Das erschwert eine Lohndifferenzierung anhand summarischer Kriterien. Sie lässt sich aber sehr wohl auch in diesem Rahmen realisieren, denn die Summarik ist hinreichend offen für die Berücksichtigung unterschiedlicher definitorischer Elemente.
Die Befürworter einer Entgeltstrukturreform glauben, die Notwendigkeit dieser Differenzierung zugleich als ein Argument für den Systemwechsel nutzen zu können. Sie führen dafür vor allem die fällige Angleichung zwischen Arbeitern und Angestellten an, ferner, dass die Mehrzahl der Arbeitsplätze inzwischen nicht mehr mit den Tarifbeschreibungen übereinstimme und dass diese in der geschlechtlichen Zuordnung nicht diskriminierungsfrei seien. So würden (überwiegend männliche) Handwerker höher eingestuft als vergleichbare kaufmännische (überwiegend weibliche) Berufe (vgl. ver.di-NRW 2012).
Besonderen Begründungsaufwand betreiben die Befürworter der Strukturumstellung mit dem Verweis auf die Praxis der »massiven Abgruppierungen« unter dem Regime des summarischen Systems (ebd.). Sie übersehen dabei aber, dass dieses Vorgehen bei einer analytischen Arbeitsbewertung ebenso möglich und prinzipiell noch leichter ist, wie zu zeigen sein wird.
Was spricht für ein analytisches Arbeitsbewertungssystem?
Die Bemühungen, die Lohnfindung zu ›optimieren‹, sind so alt wie die moderne kapitalistische Wirtschaft selbst und auch gut an der Entwicklung des Leistungslohns zu beobachten. Frederick W. Taylor hatte schon vor 120 Jahren damit begonnen, das (subjektive) Gestaltungswissen der Arbeiter durch formalisierte Optimierung zu enteignen und damit zu ›objektivieren‹, was bei Taylor nichts anderes hieß, als es an das Interesse des Betriebs zu binden. In den REFA-Ausschüssen der Weimarer Zeit (REFA = Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung) und im RKW (= Rationalisierungskomitee der deutschen Wirtschaft) waren Arbeitswissenschaftler und Betriebsingenieure darum bemüht, die vielen unterschiedlichen Rationalisierungskonzepte zu bündeln, technokratisch aufzubereiten und den Betrieben als objektives Fachwissen zur Verfügung zu stellen. Aus diesen Kreisen – mit einer gewissen Kontinuität in den 30er Jahren – stammen denn auch die ersten konkreten Überlegungen, eine ›objektive‹, d.h. nicht berufsständisch oder aushandlungspolitisch begründete, sondern allein an den konkret messbaren Arbeitsanforderungen orientierte Entgeltstruktur zu entwickeln (Schauer u.a. 1984: 35f., 56ff.).
Diese Idee wurde nach dem zweiten Weltkrieg wieder aufgegriffen und in einigen Tarifverträgen alternativ neben dem summarischen System berücksichtigt. Dabei waren neben den ›Objektivitäts‹- bzw. Anforderungskriterien noch zwei weitere Überlegungen für die gewerkschaftlichen Tarifexperten maßgeblich. Sie wollten eine »mit der Abkehr von der ausschließlich qualifikationsbezogenen Lohnbestimmung verbundene Erweiterung der lohnbegründenden Merkmale« erreichen und daneben eine Egalisierung der Lohnstrukturen, nämlich »die Verwirklichung des Grundsatzes: ›gleicher Lohn für gleiche Arbeit‹« (Schauer u.a. 1984: 58). Betrachtet man die verschiedenen Anforderungskriterien und Belastungsfaktoren, die mit ihren gewichteten Rangstufen zu Arbeitswertgruppen zusammengefasst werden, so ermöglichen sie in der Tat ein recht genaues Bild des Anforderungsprofils, das mit einem bestimmten Arbeitsplatz verbunden ist. (So wurden in Nordwürttemberg/Nordbaden 20 Bewertungsmerkmale auf einer Rangstufenskala von 0 bis 100 eingestuft, dann mit einem Gewichtungsfaktor versehen und die sich daraus ergebenden Teilarbeitswerte zu einem Gesamtarbeitswert zusammengefasst.) Das Instrument ist präziser und flexibler als die summarische Arbeitsbewertung, die zumeist nicht ohne einen umfangreichen Beispielkatalog auskommt, der zeitbezogen immer wieder überarbeitet und ergänzt werden muss.
Die analytische Arbeits- bzw. Arbeitsplatzbewertung kann also ein genaues, prinzipiell die Interessen beider Seiten angemessen berücksichtigendes Instrument der Lohnfindung sein. Seine Anwendung kann unter asymmetrischen Machtverhältnissen aber sehr stark zum Nachteil des schwächeren Partners ausschlagen – d.h., fast immer der abhängig Beschäftigten – weil es viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet als die summarische Arbeitsbewertung und mit ihr schneller auf technische oder organisatorische Veränderungen reagiert werden kann.
Ein Vergleich mit der Metallindustrie von Nordwürttemberg-Nordbaden mag das veranschaulichen. In den 60er Jahren wurde dort die analytische Methode in sehr vielen Großbetrieben der Metallverarbeitung eingeführt (später modifiziert gemäß Lohnrahmen-TV v. 1. August 1972); sie konnte wegen des hohen Organisationsgrades und starker Betriebsräte in der Regel ohne Verlust gegenüber der vorherigen summarischen Einstufung durchgesetzt werden. So konstatieren Lang/Meine/Ohl 1997, dass der Verbreitungsgrad »in Nordwürttemberg/Nordbaden bei 90 Prozent aller Arbeiter«, in anderen Tarifgebieten der Metallindustrie nur bei 10-50 Prozent liege (S. 177).
Die Gefahr einer rationalisierungsbedingten Herabstufung war allen Beteiligten damals sehr bewusst. Daher wurde bereits im Frühjahr 1968 ein Rationalisierungsschutzabkommen für die Metallindustrie geschlossen und die Anwendung des analytischen Arbeitsbewertungsverfahrens durch eine Verdienstsicherungsklausel (§ 15, Abs. 2) im neuen Lohnrahmen-TV I (v. 1. August 1972) anlässlich deshalb erforderlicher Neueinstufungen flankiert. Außerdem wurde die Umstellung zu einer Zeit gewagt, als die Effektivlöhne deutlich über die Tariflöhne gestiegen waren. In der Praxis gelang es den Betriebsräten dann auch, Veränderungen im Arbeitsablauf, die eventuell eine Herabstufung ermöglicht hätten, durch kompensatorische Strategien in anderen Bewertungsbereichen aufzufangen, mindestens aber auf der Ebene der Leistungspolitik, wo es nicht erst seit dem berühmten Lohnrahmentarifvertrag II der IGM in Nordwürttemberg/Nordbaden (v. 1. November 1973, insbes. §§ 6-10) erhebliche Mitspracherechte der Betriebsräte gibt (s. BetrVG § 87). Dadurch war es möglich, ein gutes Lohnniveau auch über schwankende und sich verändernde Arbeitsanforderungen hinweg aufrecht zu erhalten. Das führte z.B. dazu, dass die angelernte Arbeit an den Montagebändern des Daimler Benz-Werks Mannheim in den 70er Jahren zu 70-80 Prozent von Facharbeitern ausgeführt wurde, weil sie hierbei deutlich mehr verdienten als bei einem kleinen Mittelständler in ihrem gelernten Beruf (Kudera u.a. 1976: 32).
Ist die Arbeitsmarktlage aber für die Beschäftigten ungünstig und die Interessenvertretung schwach, zudem – wie im Einzelhandel – die Organisationsfähigkeit der abhängig Beschäftigten gering, dann eröffnet die analytische Arbeitsbewertungsmethode erhebliche Spielräume für das Unternehmen bzw. sein Management, mit einfachen arbeitsorganisatorischen Maßnahmen Arbeitsplatzzuschneidungen und damit auch Arbeitsbewertungen zu verändern und damit gewissermaßen auf kaltem Wege herabzustufen. Das ist nicht nur wegen der Kleinteiligkeit der Kriterien leichter durchzusetzen, sondern auch deshalb, weil subjektive Merkmale wie Qualifikation und Erfahrung hierbei kaum oder gar keine Rolle spielen.
Der eminent politische Charakter von Methoden der Arbeitsbewertung bzw. Entgeltbestimmung lässt sich gut an der Umsetzung von ERA in Baden-Württemberg aufzeigen. Zwar war es ein altes gemeinsames Ziel in der Metallindustrie, eine gemeinsame Entgeltstruktur für ArbeiterInnen und Angestellte zu finden, die Unternehmerverbände verfolgten aber in Baden-Württemberg noch ein zweites: Sie wollten mit Hilfe des neuen Vertrages die betriebliche Lohndrift, den ›Betriebsspeck‹ abtragen. Bis in die 70er Jahre hatte diese Differenz enorme Ausmaße angenommen (z.B. lagen im Mannheimer Daimler Benz-Werk 1974 die Effektivlöhne bei den unteren Arbeiterlohngruppen gut ein Drittel über den Tariflöhnen und in den oberen noch gut 20 Prozent darüber, s. Kudera u.a. 1976: 37). 30 Jahre später, zu Beginn der ERA-Umsetzung, waren diese Unterschiede weitgehend abgebaut. Die Effektivlöhne lagen nun auch in den prosperierenden Unternehmen wegen des anhaltenden Globalisierungsdrucks und der daraus folgenden Schwäche der Gewerkschaften deutlich weniger als zehn Prozent über den Tariflöhnen, vielfach waren sie mit diesen identisch. Die früher als Minimallöhne gehandhabten Tariflöhne waren auch in Baden-Württemberg zu Normallöhnen geworden (vgl. Schmidt 2001). Davon oftmals unberührt geblieben war aber die indirekte oder strukturelle ›Lohndrift‹, eine über die Anforderungsbeschreibung hinausgehende Höhereinstufung durch betriebliche Verhandlungsstärke. Die Einführung von ERA bot dem Unternehmerverband Südwestmetall die willkommene Gelegenheit, die neue ›Tarifwahrheit‹ gegen die Begünstigten durchzusetzen. Mit einer Phalanx gut geschulter Experten, die zur Unterstützung in die Betriebe geschickt wurden, sorgte Südwestmetall dafür, dass es in den Betrieben möglichst keine Nachverhandlungen (sondern die gewünschte ›Eins-zu-eins-Umsetzung‹) gab, um gemäß dem neuen Stufenwertzahlverfahren, »einer Mischung aus Analytik und Summarik« (Bahnmüller/Schmidt 209: 66), den Anforderungsbezug möglichst restriktiv zugunsten des Unternehmens auszulegen. Im Endeffekt gab es mehr ERA-Verlierer (sog. ›Überschreiter‹, d.h. Herabgestufte) als Gewinner (sog. ›Unterschreiter‹, d.h. Heraufgestufte), und aus dem vormaligen Innovations- und Emanzipationsprojekt war ein »Stabilisierungs-, Absicherungs- und Schutzprojekt« geworden (Bahnmüller/Schmidt 2009: 393).
Einmal abgesehen davon, dass die ERA-Einführung in anderen Tarifbezirken besser verlaufen und insgesamt vielschichtiger ist, als hier kurz resümiert, kann die Lehre für die geplante Entgeltstrukturreform im Einzelhandel nur heißen: Die Beschäftigten können dabei nicht gewinnen. Angesichts der unvergleichlich schwächeren Verhandlungsposition von ver.di, der Absenz hinreichend geschulter betrieblicher ExpertInnen und geringer Belegschaftsstärke können sie dabei nur verlieren. Wenn aber großzügige Verdienstsicherungen gefordert würden und die allgemeine Bildung von Betriebsräten in den bislang mitbestimmungsfreien Betrieben, würden die Unternehmen das Interesse am neuen Tarifvertrag sofort verlieren. Insofern spricht alles dafür, die vorhandenen Verfahren zu modernisieren und im Übrigen eine politische Flankierung anzustreben, mit der die Instrumente der Billiglohnkonkurrenz (Leiharbeit, Minijobs, Werkverträge etc.) für die Unternehmer ihre Attraktivität verlören.
* Rudi Schmidt ist Professor em. für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftsbeziehungen am Institut für Soziologie der Universität Jena.
Literatur:
- Bahnmüller, R./W. Schmidt (2009): »Riskante Modernisierung des Tarifsystems. Die Reform der Entgeltrahmenabkommen am Beispiel der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württembergs«, Berlin: edition sigma
- Kalkowski, P. (2008): »Ist der Flächentarifvertrag für den Einzelhandel noch zu retten? Rahmenbedingungen und Konturen einer Entgeltstrukturreform«, Göttingen (SOFI), unveröff. Forschungsbericht
- Kudera, W./W. Mangold/K. Ruff/R. Schmidt/T. Wentzke (1976): »Gesellschaftliches und politisches Bewußtsein von Arbeitern. Abschlußbericht«, vervielf. Manuskript Erlangen/Nürnberg
- Lang, K/H. Meine/K. Ohl (Hg.) (1997): »Arbeit, Entgelt, Leistung. Handbuch Tarifarbeit im Betrieb«, 2. überarb. Aufl., Köln: Bund-Verlag
- Schauer, H./H. Dabrowski/U. Neumann/H.J. Sperling (1984): »Tarifvertrag zur Verbesserung industrieller Arbeitsbeziehungen. Arbeitspolitik am Beispiel des Lohnrahmentarifvertrags II«, Frankfurt/New York: Campus
- Schmidt, R. (2001): »Erosion der Tarifsetzungsmacht«, in: J. Abel/H. J. Sperling (Hg.): »Umbrüche und Kontinuitäten. Perspektiven nationaler und internationaler Arbeitsbeziehungen«, München und Mehrung: Hampp 2001, S. 201-220
- ver.di-NRW (2012): »Ratschlag. Informationen für Betriebsräte aus dem Einzelhandel NRW«, 1. Ausgabe 2012
- WSI (2010): »WSI-Tarifhandbuch 2010«, bearb. von R. Bispinck. Frankfurt/Main: Bund-Verlag
express im Netz unter: www.express-afp.info


