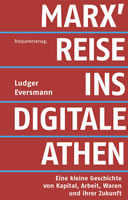
„
Es wird höchste Zeit, dass wir uns die Digitalisierung sinnvoll zunutze machen – und zwar so, dass alle etwas davon haben! Der Philosoph und Wirtschaftsinformatiker Ludger Eversmann spürt auf dieser hochspannenden Gedankenreise der Frage nach, wie wir den technischen Fortschritt in den Dienst einer neuen ökonomischen Ordnung stellen können – und wie diese Ordnung jenseits der Systemfehler des Kapitalismus aussehen könnte. Im Dialog mit klassischen und zeitgenössischen Theoretikern – u. a. Marx, Rifkin, Brynjolfsson – sucht dieses Buch nach verständlichen Antworten auf ein komplexes Problem: Wie wird die Arbeit in Zukunft verteilt sein? Gibt es ein »digitales Athen«, wo das Problem der (Über-)Produktion gelöst ist und Maschinen die Sklavenarbeit machen? Was machen dann die Menschen? Wem gehören die Maschinen? Wartet dort das »gute Leben«?“ Umschlagtext – neben weiteren Infos beim Rotpunktverlag – zum am 06.05.2019 erschienenen
Buch von Ludger Eversmann. Siehe zum Buch – als exklusive Leseprobe im LabourNet Germany – Inhaltsverzeichnis, die Einleitung „Das Einfache, das schwer zu machen ist“ und Kapitel 1: The Value of Everything – wir danken Autor und Verlag! Siehe im Beitrag zum Buch Zitate aus beiden Kapiteln und nun einen ergänzenden Artikel des Autors:
Marx und die Roboter. Was fängt der Mensch mit Maschinen an, die ihm die Arbeit abnehmen? weiterlesen »