- Automobilindustrie
- Bauindustrie und Handwerk
- Chemische Industrie
- Elektro- und Metall(-Zulieferer)
- Elektrotechnik
- Energiewirtschaft (und -politik)
- Fahrzeugbau (Vom Fahrrad, über Trecker bis zum Flugzeug)
- Gewerkschaften als Arbeitgeber
- Holz, Papier, Glas und Kunststoffe
- Landwirtschaft und Gartenbau
- Lebens- und Genussmittelindustrie
- Maschinen- und Anlagenbau
- Medien und Informationstechnik
- Rüstungsindustrie und -exporte
- Sonstige Branchen
- Stahl-Industrie
- Stoffe und Bekleidung
- Abfall/Umwelt/Ver-/Entsorgung
- Banken und Versicherungen
- Call-Center
- Dienstleistungen allgemein/diverse
- Gastronomie und Hotelgewerbe
- Gesundheitswesen
- Groß- und Einzelhandel
- Kultur und/vs Freizeitwirtschaft
- Öffentlicher Dienst und Behörden
- Reinigungsgewerbe und Haushalt
- Sex-Arbeit
- Soziale Arbeit, Kirche und Wohlfahrts-/Sozialverbände
- Sportwirtschaft
- Transportwesen: (Öffentlicher) Personen (Nah)Verkehr
- Transportwesen: Bahn
- Transportwesen: Hafen, Schiffe und Werften
- Transportwesen: Luftverkehr
- Transportwesen: Post- und Paketdienste
- Transportwesen: Speditionen und Logistik
- Wachdienste und Sicherheitsgewerbe
Deutsches Schulbarometer 2024 der Robert Bosch Stiftung: Jeder fünfte junge Mensch berichtet von psychischen Problemen
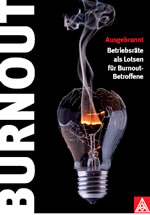 „Erstmals hat die Robert Bosch Stiftung im Rahmen des Deutschen Schulbarometers Schülerinnen und Schüler zu ihrem psychischen und schulischen Wohlbefinden befragt. Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage sind alarmierend: (…) Bei etwa jedem fünften jungen Menschen (21 Prozent) zeigen sich psychische Auffälligkeiten. Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche, deren Eltern oft oder sehr oft finanzielle Sorgen haben. Hier liegt der Anteil derjenigen, die sich als psychisch auffällig beschreiben, bei 33 Prozent. (…) Über ein Viertel (27 Prozent) der Schülerinnen und Schüler empfinden ihre Lebensqualität als gering. (…) Die Sorge um Kriege in der Welt belastet die Kinder und Jugendlichen zum Zeitpunkt der Befragung am häufigsten…“ Artikel von Florentine Anders vom 20. November 2024 beim Deutschen Schulportal der Robert Bosch Stiftung
„Erstmals hat die Robert Bosch Stiftung im Rahmen des Deutschen Schulbarometers Schülerinnen und Schüler zu ihrem psychischen und schulischen Wohlbefinden befragt. Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage sind alarmierend: (…) Bei etwa jedem fünften jungen Menschen (21 Prozent) zeigen sich psychische Auffälligkeiten. Besonders betroffen sind Kinder und Jugendliche, deren Eltern oft oder sehr oft finanzielle Sorgen haben. Hier liegt der Anteil derjenigen, die sich als psychisch auffällig beschreiben, bei 33 Prozent. (…) Über ein Viertel (27 Prozent) der Schülerinnen und Schüler empfinden ihre Lebensqualität als gering. (…) Die Sorge um Kriege in der Welt belastet die Kinder und Jugendlichen zum Zeitpunkt der Befragung am häufigsten…“ Artikel von Florentine Anders vom 20. November 2024 beim Deutschen Schulportal der Robert Bosch Stiftung ![]() zur Studie und mehr daraus/dazu:
zur Studie und mehr daraus/dazu:
- Psychische Erkrankungen bei Jugendlichen: Sie sind noch nicht mal im Beruf und schon erschöpft

„Die Pandemie, Kriege und Klimakrise hinterlassen Spuren: Psychische Erkrankungen nehmen unter Jugendlichen stark zu. Mit ihnen steigen die Kosten für die Gesellschaft. (…) Die Jugend hat sich noch nicht von der Corona-Pandemie erholt. Das belegen zahlreiche Studien wie die Shell-Jugendstudie , die COPSY-Studie
, die COPSY-Studie  oder der DAK-Kinder- und Jugendreport
oder der DAK-Kinder- und Jugendreport  . Die junge Generation steht wie kaum eine andere unter Druck. Krieg in Europa und im Nahen Osten, die drohende Aufrüstung und der Militärdienst, den nun auch junge Menschen wieder leisten sollen. Dann kommt noch die Klimakrise hinzu. Nicht zu vergessen sind die Auswirkungen von sozialen Medien und Handynutzung auf die psychische Gesundheit junger Menschen. Die junge Generation ist erschöpft, schon bevor sie den Arbeitsmarkt erreicht. Und das könnte teuer werden. Psychische Erkrankungen verursachen schon jetzt enorme volkswirtschaftliche Kosten. (…)
. Die junge Generation steht wie kaum eine andere unter Druck. Krieg in Europa und im Nahen Osten, die drohende Aufrüstung und der Militärdienst, den nun auch junge Menschen wieder leisten sollen. Dann kommt noch die Klimakrise hinzu. Nicht zu vergessen sind die Auswirkungen von sozialen Medien und Handynutzung auf die psychische Gesundheit junger Menschen. Die junge Generation ist erschöpft, schon bevor sie den Arbeitsmarkt erreicht. Und das könnte teuer werden. Psychische Erkrankungen verursachen schon jetzt enorme volkswirtschaftliche Kosten. (…)
Die jüngeren, sagt Inholte, hielten schlechter als die älteren Generationen unbequeme Situationen aus. Rund 20 Prozent der Ausbildungsverträge würden schon nach einem Jahr wieder gebrochen. „Unsere jungen Menschen müssen erst mal lernen, Sachen auszuhalten und auch mal Tätigkeiten zu machen, die gerade keinen Spaß machen“, sagt Inholte. Sind die Jungen also faul oder gar verwöhnt?
Faule Generation-Z?
Wenn man Quentin Gärtner danach fragt, wird er geradezu wütend. „Wir haben ein ernst zu nehmendes Problem“, sagt der 18-Jährige. Gärtner ist in den letzten Monaten so etwas wie der Sprecher der jungen Generation geworden, zumindest in den Medien. Denn der 18-Jährige ist Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und vertritt in diesem Amt die Interessen der jungen Generation. Gärtner hat selbst in diesem Jahr Abitur gemacht, sein Mandat für die Schülerkonferenz endet bald. Trotzdem hängt er sich rein, die Lobbystimme seiner Generation zu sein. „Es belastet unsere Volkswirtschaft, wenn viele junge Menschen, von denen es sowieso nicht mehr so viele gibt, nicht resilient auf den Arbeitsmarkt kommen.“ Oder gar nicht auf den Arbeitsmarkt kommen.
„Es reicht offenbar nicht, einfach nur nach Hilfe zu rufen“, sagt Gärtner. „Wir müssen zeigen, dass es sich hier um ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt.“ Deshalb sind Gärtner und die Bundesschülerkonferenz zum Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) gegangen. (…)
Die Auswirkungen von psychischer Gesundheit auf den Arbeitsmarkt sind laut den Studienergebnissen schon jetzt zu sehen: 65,7 Prozent der unter 30-Jährigen, die 2024 erstmals Erwerbsminderungsrente erhielten, taten dies aufgrund psychischer Erkrankungen. Auswertungen von Zahlen der DAK-Krankenkasse zeigten, dass Fehlzeiten durch psychische Erkrankungen im Durchschnitt bei 32,9 Tagen jährlich liegen.
bei 32,9 Tagen jährlich liegen.
Angesichts des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels werden solche Ausfälle immer kritischer. „Die vielen Menschen, die in nächster Zeit in den Ruhestand gehen, müssen auf dem Arbeitsmarkt ersetzt werden“, sagt Studienautorin Anger. „Wir stehen vor einer großen Transformation, und es ist wichtig, dass die nachfolgende Generation darauf vorbereitet wird.“ Die Zahlen zeigen aber, dass dies nicht der Fall ist…“ Artikel von Clara Suchy vom 10. November 2025 in der Zeit online
- Weiter aus dem Artikel von Florentine Anders vom 20. November 2024 beim Deutschen Schulportal der Robert Bosch Stiftung
 : „… Für viele ist auch Leistungsdruck in der Schule ein Belastungsfaktor. 59 Prozent sagen, dass sie sich oft oder manchmal darum sorgen, keine guten Leistungen in der Schule zu erbringen. Besonders Mädchen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren (43 Prozent) und Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (36 Prozent) sorgen sich um ihre schulischen Leistungen. Und fast zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler (61 Prozent) macht sich Sorgen um das Klima und die Umwelt. (…) 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen geben ein geringes schulisches Wohlbefinden an. Überdurchschnittlich oft gilt dies für Schülerinnen und Schüler aus Familien mit niedrigem Einkommen (30 Prozent). Auch die psychische Gesundheit spielt eine große Rolle. Von den Kindern und Jugendlichen, die über psychische Auffälligkeiten berichten, geben 58 Prozent ein geringes schulisches Wohlbefinden an. Bei den psychisch unauffälligen Kindern liegt der Anteil dagegen nur bei 14 Prozent. (…) Handlungsbedarf zeigt sich laut Bericht vor allem bei der Klassenführung. Die große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler (83 Prozent) berichtet von häufigen Unterrichtsstörungen. Auch bei der konstruktiven Unterstützung gibt es Entwicklungsbedarf. 41 Prozent geben an, dass keine oder nur wenige Lehrkräfte nachfragen, was man bereits verstanden hat und was nicht. 37 Prozent der Schülerinnen und Schüler sagen, dass keine oder nur wenige Lehrkräfte ihnen zurückmelden, was sie schon können und was sie noch lernen müssen. Allerdings sagen auch 75 Prozent, dass die meisten oder alle Lehrkräfte freundlich zu ihnen sind. (…) Ein Viertel der Erziehungsberechtigten (24 Prozent) glaubt, dass ihr Kind aufgrund psychischer Probleme in den vergangenen zwölf Monaten Hilfe benötigt hat oder hätte. Jedoch haben 28 Prozent dieser Eltern keine Hilfe gesucht oder waren dazu nicht in der Lage. (…) Die meisten Kinder oder Jugendlichen (70 Prozent) geben an, zu wissen, an wen sie sich in der Schule bei emotionalen Problemen wenden können. Aber mehr als ein Viertel (27 Prozent) zweifelt daran, dass jemand in der Schule helfen könne. Bei den Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen sind es sogar 45 Prozent. 11 Prozent der Befragten berichten, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn sie in der Schule solche Probleme mit anderen besprochen haben. Bei Schülerinnen und Schüler mit psychischen Auffälligkeiten sind es 26 Prozent.“
: „… Für viele ist auch Leistungsdruck in der Schule ein Belastungsfaktor. 59 Prozent sagen, dass sie sich oft oder manchmal darum sorgen, keine guten Leistungen in der Schule zu erbringen. Besonders Mädchen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren (43 Prozent) und Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (36 Prozent) sorgen sich um ihre schulischen Leistungen. Und fast zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler (61 Prozent) macht sich Sorgen um das Klima und die Umwelt. (…) 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen geben ein geringes schulisches Wohlbefinden an. Überdurchschnittlich oft gilt dies für Schülerinnen und Schüler aus Familien mit niedrigem Einkommen (30 Prozent). Auch die psychische Gesundheit spielt eine große Rolle. Von den Kindern und Jugendlichen, die über psychische Auffälligkeiten berichten, geben 58 Prozent ein geringes schulisches Wohlbefinden an. Bei den psychisch unauffälligen Kindern liegt der Anteil dagegen nur bei 14 Prozent. (…) Handlungsbedarf zeigt sich laut Bericht vor allem bei der Klassenführung. Die große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler (83 Prozent) berichtet von häufigen Unterrichtsstörungen. Auch bei der konstruktiven Unterstützung gibt es Entwicklungsbedarf. 41 Prozent geben an, dass keine oder nur wenige Lehrkräfte nachfragen, was man bereits verstanden hat und was nicht. 37 Prozent der Schülerinnen und Schüler sagen, dass keine oder nur wenige Lehrkräfte ihnen zurückmelden, was sie schon können und was sie noch lernen müssen. Allerdings sagen auch 75 Prozent, dass die meisten oder alle Lehrkräfte freundlich zu ihnen sind. (…) Ein Viertel der Erziehungsberechtigten (24 Prozent) glaubt, dass ihr Kind aufgrund psychischer Probleme in den vergangenen zwölf Monaten Hilfe benötigt hat oder hätte. Jedoch haben 28 Prozent dieser Eltern keine Hilfe gesucht oder waren dazu nicht in der Lage. (…) Die meisten Kinder oder Jugendlichen (70 Prozent) geben an, zu wissen, an wen sie sich in der Schule bei emotionalen Problemen wenden können. Aber mehr als ein Viertel (27 Prozent) zweifelt daran, dass jemand in der Schule helfen könne. Bei den Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen sind es sogar 45 Prozent. 11 Prozent der Befragten berichten, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn sie in der Schule solche Probleme mit anderen besprochen haben. Bei Schülerinnen und Schüler mit psychischen Auffälligkeiten sind es 26 Prozent.“ - Zu weiteren Details siehe das komplette 124-seitige Deutsche Schulbarometer der Robert Bosch Stiftung vom Oktober 2024


- Bundesschülersprecher fordert mehr Schulpsychologen an Schulen
„Fabian Schön, Generalsekretär der deutschen Bundesschülerkonferenz, warnt davor, die hohe Zahl der psychisch belasteten Kinder und Jugendlichen als „Normalzustand“ hinzunehmen. Schulen müssten dringend stärker auf die emotionalen Probleme eingehen und auch ausgebildetes Personal dafür bekommen, so der Schülervertreter im Interview zu den Ergebnissen des Deutschen Schulbarometers, das das psychische Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen untersucht hat.“… Fabian Schön: Als wir in unserer kleinen Vorstandsrunde das aktuelle Schulbarometer angeschaut haben, ist uns gemeinsam aufgefallen, dass uns diese Zahl gar nicht mehr schockiert – und gerade diese Erkenntnis hat uns am meisten schockiert! Wir nehmen es offenbar als Normalzustand hin, dass so viele unserer Mitschülerinnen und Mitschüler von psychischen Problemen betroffen sind. Wir nehmen es hin, als sei das nicht zu ändern, weil wir in der Vergangenheit auch überhaupt keine Anstrengungen gesehen haben, die Zahl langfristig zu senken. Jeder Fünfte bedeutet, dass in einer Klasse mit 30 Schülerinnen und Schülern sechs Personen betroffen sind. (…) Sicher spielt die aktuelle gesamtgesellschaftliche Lebenssituation eine große Rolle, und auch Corona hat bekanntlich Spuren hinterlassen und häufig zur Vereinsamung geführt. Aber das Problem lässt sich nicht allein auf die Coronapandemie zurückführen. (…) Wir als Bundesschülerkonferenz sehen Ursachen auch in der Schule. Da geht es um Stress, um Leistungsdruck, der jeden Tag aufs Neue auf die Schülerinnen und Schüler ausgeübt wird. Es gibt gerade in der Oberstufe Schülerinnen und Schüler, die gehen fast jeden Tag mit einem unguten Gefühl in der Schule, weil sie Angst haben, in einem anstehenden Test nicht die nötige Leistung zu erbringen. Dieser Erwartungsdruck hat natürlich Folgen für die mentale Gesundheit. Auch wenn der Leistungsdruck nicht der alleinige Grund für die psychischen Belastungen ist, könnte ein anderes Schulklima viel zum Wohlbefinden beitragen. (…) Über psychische Probleme zu reden ist immer noch ein Tabu. Eine solche Enttabuisierung gelingt jedoch nicht von heute auf morgen – das braucht Zeit, die die aktuell betroffenen Kinder und Jugendlichen nicht haben. Deshalb plädieren wir für eine Übergangslösung, es braucht „Safe Places“ in der Schule – also Räume, wo es möglich ist, über emotionale Probleme zu sprechen. Es bräuchte eine Psychologin oder einen Psychologen, der oder die ein Büro mit festen Sprechzeiten vor Ort hat. Auch mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, die fest in multiprofessionelle Teams integriert sind, kann schon viel erreicht werden. Davon gibt es immer noch viel zu wenige. Oft ist es so, dass eine Person mehrere Schulen parallel betreut – da ist es unmöglich, immer vor Ort zu sein. Gleichzeitig ist es wichtig, die Schülerinnen und Schüler im Unterricht über psychische Erkrankungen und deren Symptome aufzuklären und auch darüber, wo man Hilfe finden kann. (…) Idealerweise sollten diese Räume so sein, wie es sich die Schülerinnen und Schüler selbst vorstellen. Das hängt ja von den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler vor Ort ab, und die sind an jeder Schule anders. Uns ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler gefragt und an der Gestaltung der Schule beteiligt werden. Dann werden sie sich in den Räumen auch wohlfühlen.“ Interview von Florentine Anders vom 20. November 2024 beim Deutschen Schulportal der Robert Bosch Stiftung
- GEW: „Wohlbefinden der Lernenden muss Indikator für Schulqualität werden!“ Bildungsgewerkschaft zum Schulbarometer der Bosch Stiftung
„Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mahnt an, das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen ins Zentrum schulpolitischer Maßnahmen zu rücken und in ein ausgewogenes Verhältnis zu Unterricht und kognitiven Anforderungen in den Schulen zu setzen. „Die Ergebnisse des Schulbarometers sind alarmierend und besorgniserregend. Psychische Probleme können in einen Teufelskreis münden, der ganze Bildungsbiografien ins Wanken bringen kann. Die Schulen brauchen mehr Zeit und mehr multiprofessionelles Personal, um dem zu begegnen. Die schulpolitische Fokussierung auf immer mehr Diagnosen und Tests in den Kernfächern ist kontraproduktiv. Leistung und Lehrpläne sind nicht die besten Wegweiser durch die Krisen“, sagte Anja Bensinger-Stolze, GEW-Vorstandsmitglied Schule, mit Blick auf das Schulbarometer der Robert Bosch Stiftung, das heute veröffentlicht worden ist. „Schulen müssen als sichere, gesunde und wertschätzende Orte erlebt werden. Angesichts einer unsicheren Zukunft ist es von zentraler Bedeutung, Räume für soziale Beziehungen, Erfolgserlebnisse und Selbstwirksamkeit zu eröffnen, eine positive Fehlerkultur zu etablieren sowie die psychische und physische Resilienz der Kinder und Jugendlichen zu fördern“, betonte Bensinger-Stolze. Sie schlug vor, das Wohlbefinden der Lernenden und Lehrenden als Indikator für Schulqualität einzuführen. Das GEW-Vorstandsmitglied begrüßte, dass das Schulbarometer Lernprozesse statt Lernergebnisse sowie die Bedeutung von Feedback und demokratischer Teilhabe stark akzentuiere. „Demokratie muss für alle Kinder und jungen Menschen erfahrbar und erlebbar sein. Gerade weil die befragten Schülerinnen und Schüler so deutlich Ängste mit Blick auf Kriege, Klimakrise und ihre eigene Zukunft äußern, ist es wichtig, dass Schulen Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen und die Lernenden die Welt wie auch ihre eigene Schule als gestaltbar erleben“, unterstrich Bensinger-Stolze. „Voraussetzung dafür sind deutlich mehr Zeit im Schulalltag, also die Senkung der Unterrichtsverpflichtung, die bessere personelle Ausstattung mit Lehrkräften sowie mit Personal der Schulsozialarbeit und -psychologie“, sagte die GEW-Schulexpertin. Aber auch niedrigschwelligere Angebote wie die in einigen Bundesländern etablierten „Mental-Health-Coaches“ müssten ausgebaut und verstetigt werden. Mit zeitlich befristeten Projektmitteln sei jedoch weder den psychosozialen Problemen der Schülerinnen und Schüler noch der chronischen Überlastung der Beschäftigten an Schulen beizukommen, betonte Bensinger-Stolze. Sie sprach sich für die Etablierung von Gesundheitspersonal an Schulen aus, wie es etwa in Skandinavien zum Standard gehöre. Auch die gesundheitliche Versorgungsstruktur im Sozialraum müsse bekannter gemacht und ausgebaut werden. „Die langfristige Perspektive heißt: die schulische Auslese und die chronische Unterfinanzierung im Schulwesen beenden!“, hob Bensinger-Stolze hervor.“ GEW-Stellungnahme vom 20. November 2024
Siehe vom April 2024: Deutsches Schulbarometer 2024 der Robert Bosch Stiftung: Erschöpfte Lehrkräfte leiden unter Gewalt, Personalmangel und mangelder Ausstattung


